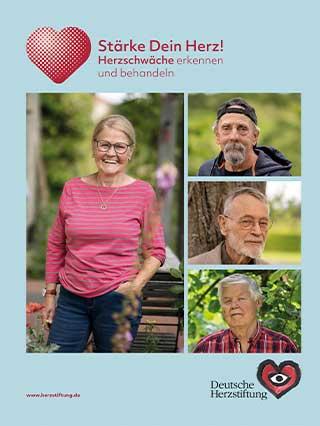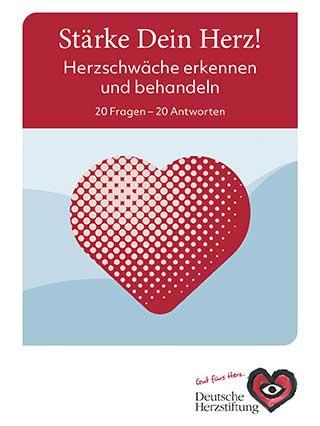Unser Interview-Partner:
Professor Dr. Gerhard Hindricks ist kommissarischer Direktor der Klinik für Kardiologie und Intensivmedizin des Deutschen Herzzentrums der Charité in Berlin, einer der größten herzmedizinischen Einrichtungen in Europa. Das besondere Forschungsinteresse des Kardiologen und Mitglieds im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung gilt dem Einsatz und Nutzen der Künstlichen Intelligenz in der Herzmedizin.
HERZ heute: Herr Professor Hindricks, eine Blutprobe hat jeder schon einmal abgegeben. Aber eine Stimmprobe?
Professor Dr. Gerhard Hindricks: Dafür braucht man keine Nadel, nur ein gutes Mikrophon. Für die Stimmprobe liest die Patientin oder der Patient für etwa 15 Sekunden einen Satz laut vor, er wird aufgenommen und anschließend auf bestimmte Charakteristika hin analysiert.
Geben Sie die Sätze vor?
Ja. Wir verwenden zum Beispiel den Anfang einer Erzählung, die dem altgriechischen Dichter Äsop zugeschrieben wird: „Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam …“
Das klingt jetzt ein bisschen wie im Theater. Dabei arbeiten Sie im Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin.
Unser Team sammelt die Aufnahmen der Sätze im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung, der „VAMP-HF-Studie“. Wir führen sie zusammen mit der US-amerikanischen Mayo Clinic in Rochester durch.
Was verbirgt sich hinter der Abkürzung?
VAMP-HF steht für „AI-Based Voice Analysis for Monitoring Patients Hospitalized with Acute Decompensated Heart Failure“. Auf Deutsch: KI-gestützte Stimmanalyse zur Überwachung von Krankenhauspatienten mit akuter dekompensierter Herzinsuffizienz.
Einfach besser informiert
Werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung
Unterstützen Sie uns mit mindestens 36,00 Euro im Jahr bei unserer Aufklärungsarbeit und Forschungsförderung rund um Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag können Sie z.B. online auf alle Expertenschriften und Artikel zugreifen.
Und warum wollen Sie die Stimme von Patienten mit Herzschwäche, medizinisch Herzinsuffizienz, analysieren?
Es geht darum festzustellen, wie sich die Stimme verändert, wenn Patientinnen oder Patienten mit fortgeschrittener Herzschwäche in eine akute Krise geraten und durch eine sogenannte kardiale Dekompensation gehen.
Was geschieht dabei im Körper?
Bei einer kardialen Dekompensation sind alle Selbsthilfemaßnahmen des Körpers erschöpft, die Pumpschwäche des Herzens auszugleichen. Blut staut sich vor dem Herzen, über diverse Rückkopplungsschleifen sind auch die Nieren und somit die Wasserausscheidung beeinträchtigt. Wasser lagert sich überall im Körper ein, vor allem in den Armen und Beinen, aber auch in der Lunge und eben auch in den Stimmbändern.
Die von einer solchen Dekompensation Betroffenen brauchen dringend medizinische Hilfe.
Unbedingt. Der Zustand kann lebensbedrohlich werden. Die Menschen, die an unserer Studie teilnehmen, wurden aufgrund eines solchen Zustandes einige Tage bei uns in der Klinik in Berlin-Mitte aufgenommen. Wir behandeln sie unter anderem mit Medikamenten, die das Ausscheiden von Wasser erhöhen, und stellen ihre Medikation insgesamt neu ein.
Und analysieren zugleich, ob sich die Stimme während der Krise verändert hat – und ob sie sich nach der Behandlung wieder normalisiert?
Ja, das wollen wir herausfinden. Begleitend zur medizinischen Behandlung erfolgen bei uns deshalb die Sprachanalysen. Wir suchen nach subtilen Veränderungen, nach Klanghinweisen, die uns Auskunft über den Krankheitsverlauf geben können. Solche Veränderungen und Zusammenhänge kann die Künstliche Intelligenz, kurz: KI, feststellen. Wir arbeiten dazu mit einem Berliner Start-up namens Noah Labs zusammen. Das Software-Unternehmen hat sich unter anderem darauf spezialisiert, eine stimmbasierte Diagnostik für Herzerkrankungen zu entwickeln.
Die von einer solchen Dekompensation Betroffenen brauchen dringend medizinische Hilfe.
Unbedingt. Der Zustand kann lebensbedrohlich werden. Die Menschen, die an unserer Studie teilnehmen, wurden aufgrund eines solchen Zustandes einige Tage bei uns in der Klinik in Berlin-Mitte aufgenommen. Wir behandeln sie unter anderem mit Medikamenten, die das Ausscheiden von Wasser erhöhen, und stellen ihre Medikation insgesamt neu ein.
Und analysieren zugleich, ob sich die Stimme während der Krise verändert hat – und ob sie sich nach der Behandlung wieder normalisiert?
Ja, das wollen wir herausfinden. Begleitend zur medizinischen Behandlung erfolgen bei uns deshalb die Sprachanalysen. Wir suchen nach subtilen Veränderungen, nach Klanghinweisen, die uns Auskunft über den Krankheitsverlauf geben können. Solche Veränderungen und Zusammenhänge kann die Künstliche Intelligenz, kurz: KI, feststellen. Wir arbeiten dazu mit einem Berliner Start-up namens Noah Labs zusammen. Das Software-Unternehmen hat sich unter anderem darauf spezialisiert, eine stimmbasierte Diagnostik für Herzerkrankungen zu entwickeln.
Seit wann beschäftigt man sich in der Medizin mit einer KIgestützten stimmbasierten Diagnostik?
Das Thema wird bereits seit etwa zehn Jahren erforscht.
Ging es von Anfang an um Herzerkrankungen?
Anfangs konzentrierte sich die Wissenschaft auf neurodegenerative Erkrankungen, also auf Erkrankungen, die mit dem Untergang von Nervenzellen einhergehen. Der Zusammenhang zwischen Herz und Stimme ist erst seit zwei, drei Jahren in den Blick der Forscherinnen und Forscher geraten.
Haben Sie ein Beispiel für die Stimmanalyse bei neurodegenerativen Erkrankungen?
Ein Beispiel ist Parkinson, die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung nach Alzheimer. Bei Parkinson-Kranken kann sich die Stimme bereits in einem frühen Stadium auffällig verändern, sie wird leiser, brüchiger und zittriger. Zugleich wird die Aussprache verwaschener. KI-Anwendungen können diese Veränderungen mit relativ hoher Genauigkeit erkennen.
Und was nutzt das dem Patienten?
Die stimmbasierte KI kann Medizinerinnen und Medizinern dabei helfen, Parkinson-Erkrankungen früh zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Dass eine Erkrankung wie Parkinson die Sprache auf charakteristische Weise verändert, kann man sich auch als medizinischer Laie vorstellen.
In der Tat, wenn jemand aufgrund einer beginnenden Parkinson-Erkrankung anders spricht, fällt das auch den Mitmenschen auf. Deshalb lag der Gedanke nahe, in diesem Bereich der Medizin Stimmproben zur Diagnose zu nutzen. Inzwischen kann die KI uns zunehmend auch auf weniger auffällige oder sogar für Menschen unmerkliche Stimmveränderungen hinweisen – nicht nur in der Herzmedizin
Wo denn noch?
Personen mit einem Typ-2-Diabetes und hohen Blutzuckerwerten haben häufig eine eher schwache, etwas heisere Stimme. In einer kanadischen Studie fanden Forscher mit der KI stimmliche Merkmale, die Personen mit und ohne Diabetes unterscheiden. Eine derartige KI-Anwendung wird sich künftig womöglich nutzen lassen, um größere Bevölkerungsgruppen zu screenen, etwa mithilfe des Smartphones.
Und was wäre hier der Nutzen?
In Deutschland wissen schätzungsweise zwei Millionen Menschen nichts von ihrer Diabetes-Erkrankung. Wenn die KI aufgrund der Stimmanalyse einen ersten Verdacht meldet, würde man der betreffenden Person vorschlagen, den Blutzuckerspiegel regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf behandeln zu lassen. Je länger ein Diabetes unentdeckt voranschreitet, desto eher kommt es zu Folgeerkrankungen, etwa koronarer Herzkrankheit. Deshalb ist es wichtig, einen dauerhaft zu hohen Blutzuckerspiegel frühzeitig zu erkennen und konsequent zu behandeln.
Heiser ist jeder einmal. Was verursacht die spezielle Form von Heiserkeit bei Diabetes?
Das weiß man noch nicht genau. Vermutlich beeinflusst ein dauerhaft zu hoher Zuckerspiegel im Blut die Elastizität der Stimmbänder und schädigt sowohl die Muskulatur als auch die Nerven des Kehlkopfs.
Jetzt spenden

Forschung für die Patienten
Die Deutsche Herzstiftung fördert intensiv die Herz-Kreislauf-Forschung, damit Herzpatienten und -patientinnen besser behandelt werden können.
Zurück zum Herzen. Was hat eine dekompensierte Herzschwäche mit der Stimme zu tun?
Wenn sich mehr Flüssigkeit im Körper befindet, breiten sich die Schallwellen anders aus. Insbesondere die Wasseransammlungen in der Lunge und im Bereich der Stimmbänder und Stimmlippen verändern den Klang der Stimme.
Die KI misst also anhand der Stimme den Flüssigkeitsstand im Körper?
So in etwa kann man sich das vor-stellen. Aber uns interessieren auch andere Zusammenhänge. Bei unseren Analysen setzen wir viele verschiedene Informationen in Beziehung zueinander. So können wir zum Beispiel testen, inwieweit subtile Stimmveränderungen etwas mit der Herzfrequenz, dem Blutdruck oder dem Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten zu tun haben.
Glauben Sie wirklich, reproduzierbare Zusammenhänge zwischen Stimme und Krankheitsverlauf zu finden?
Derzeit sieht es in der Tat so aus, als ob sich diese Erwartung erfüllen würde.
Wann sind endgültige Studienergebnisse zu erwarten?
Das wird noch einige Zeit dauern. Aktuell untersuchen wir in der Charité die Daten von etwa 60 Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche, hinzu kommen die Daten aus der Mayo Clinic in Rochester. Nach den Auswertungen werden wir alle Ergebnisse ausführlich diskutieren. Erst danach können wir eine abschließende Bewertung vorlegen. Wir wollen ja keine kurzfristige Sensation! Wir wollen den Menschen zuverlässige Angebote machen, die ihre Lebensqualität verbessern.
Noch einmal konkret: Was versprechen Ihre Forschungsarbeiten im Hinblick auf die Lebensqualität von Herzschwächepatienten?
Es geht auf lange Sicht darum, die Stimme als Frühwarnsystem zu nutzen. Personen mit schwerer Herzschwäche könnten dann beispielsweise ihre Stimme per Smartphone zu Hause aufnehmen und zur Auswertung übermitteln.
Und was geschieht, wenn das KIbasierte Programm entdeckt, dass sich die Stimme einer telemedizinisch betreuten Person auffällig verändert hat?
Der Patient kann zu Hause ärztlich beraten und seine Therapie rechtzeitig angepasst werden. Dann muss es erst gar nicht so weit kommen, dass er mit erheblichen Wassereinlage-rungen und akuter Luftnot ins Krankenhaus eingeliefert wird. Das ist ein erheblicher Gewinn an Lebensqualität. Hinzu kommt, dass sich die Herzschwäche mit jeder Dekompensation verschlechtert. Auch das ließe sich verhindern.
Wenn der Körper Wasser einlagert, steigt das Körpergewicht. Wäre es für Menschen mit schwerer Herzschwäche nicht einfacher, sich auf eine Waage zu stellen, um Krisen frühzeitig zu erkennen?
Unsere Patienten sind meist älter, und das tägliche Wiegen fällt ihnen oft schwer. Eine schnelle Gewichtszunahme wird auch nicht immer mit einer drohenden Dekompensation in Zusammenhang gebracht, sondern eher damit, zu viel gegessen zu haben. Wir meinen, dass es einfacher ist, wenn Betroffene täglich ihren Satz ins Telefon sprechen. Und es ist zuverlässiger.
Eine Künstliche Intelligenz, die Krankheiten über die Analyse der Stimme diagnostiziert … kann sie bald auch Ärztin oder Arzt ersetzen?
Die technischen Möglichkeiten der KI entwickeln sich derzeit sehr dynamisch. Wir können mit ihrer Hilfe in einer zuvor kaum vorstellbaren Geschwindigkeit und Tiefe Einblick in biologische Daten und Abläufe gewinnen. Es ist eine enorm spannende Zeit in der Medizin! Die Künstliche Intelligenz kann ärztliches Handeln aber immer nur unterstützen – wie andere technische Anwendungen auch.
Zum Schluss interessiert es mich noch, welche Ansprüche an die Texte für die Stimmproben gestellt werden.
Die Fachleute von Noah Labs achten darauf, dass der Satz möglichst gute Sprachqualitäts-Signale übermitteln kann. Aber es geht dabei auch um Motivation und Freude: Je interessanter man die Stimmprobe gestaltet, desto leichter fällt es den Menschen, jeden Tag an sie zu denken.
Die Fragen stelle Susanne Paulsen, Wissenschaftsjournalistin
Download- und Bestellangebot
-
![Stärke Dein Herz (Titelbild)]()
Stärke Dein Herz! (2024)
PDF: 6,14 MB -
![20 Fragen Herzschwäche]()
Herzschwäche: 20 Fragen
PDF: 1 MB