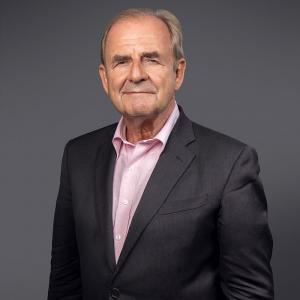Das Verständnis der Herzinfarkt-ähnlichen spontanen Koronargefässdissektion (SCAD), bei der es zu einem gefährlichen Riss in der Gefäßinnenwand eines Herzgefäßes kommt, ist nach wie vor unvollständig. Bislang gibt es nur wenige Langzeitdaten aus kontrollierten Studien zu dieser Erkrankung, die vor allem noch eher junge Frauen betrifft. Unklar ist vor allem: Wie ist die langfristige Prognose? Und wie könnte sich spätere Risiken vielleicht vorhersagen lassen?
Eine australisch-neuseeländische Forschergruppe hat sich daher genau dieser Fragen in einer Studie angenommen. Sie haben dazu die Daten von 505 SCAD-Patienten – überwiegend Frauen – zusammengetragen. Ein potenzieller Auslöser der SCAD wurde bei knapp der Hälfte der Patienten festgestellt, wobei emotionaler Stress und körperlicher Stress die häufigsten Auslöser waren. Die linke vordere absteigende Arterie war das am häufigsten von SCAD betroffene Gefäß (50%).
Nach den Ereignis wurden die Betroffenen über im Mittel 21 Monate weiter beobachtet. Von den Patienten mit SCAD erlitten knapp neun Prozent im weiteren Verlauf eine schwerwiegend Komplikation: sie starben, hatten einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder sie mussten sich einer Bypassoperation oder einem Stenteingriff unterziehen. Bei 3,6 Prozent trat erneut eine SCAD auf.
Blutverdünnung erhöht offenbar Risiko für Komplikationen
Die Wissenschaftler werteten zudem die Medikamenteneinnahme aus und welche kardiovaskulären Erkrankungen bereits zuvor bestanden. Dabei fanden sie einige Anhaltspunkte, die als Risikofaktoren für Komplikationen nach SCAD gewertet werden können.
So erhöhte
- eine Behandlung mit oralen Antikoagulanzien das Risiko für schwerwiegende Komplikationen um das 3,8-fache.
- eine duale Hemmung der Blutplättchenfunktion mit zwei Thrombozytenaggregationshemmern (ASS + Ticagrelor) das Risiko um nahezu das Doppelte.
- eine fibromuskuläre Dysplasie (eine nicht-entzündlich bedingte Verdickung der Arterienwand durch Wucherung glatter Muskelzellen) auf das Risiko aus.
- ein vorangegangener Schlaganfall das Risiko ebenfalls um das 3,8-fache.
Die Wissenschaftler fanden auch drei Faktoren, die offenbar mit einem erhöhten Risiko für eine erneute SCAD verbunden sind. Dieses Risiko wurde bei einem Schlaganfall in der Vorgeschichte versechsfacht. Eine fibromuskuläre Dysplasie vervierfachte das Risiko. Und Bei einer doppelten Blutplättchenhemmung war die Gefahr für ein SCAD-Rezidiv immerhin noch um das 2,6-fache erhöht.
Erkenntnisse helfen bei der Patientenbetreuung
Die Wissenschaftler folgern aus diesen Daten, dass insbesondere Patientinnen und Patienten mit SCAD engmaschig betreut werden müssen, bei denen bereits ein Schlaganfall bekannt ist oder eine fibromuskuläre Dysplasie. In der weiteren Behandlung sollte möglichst auf eine Therapie mit oralen Antikoagulanzien und auf eine duale Blutplättchenhemmung (mit ASS + Ticagrelor) verzichtet werden.
Transparenz: Daher beziehen wir unsere Infos
- The Australian-New Zealand spontaneous coronary artery dissection cohort study: predictors of major adverse cardiovascular events and recurrence; DOI: 10.1093/eurheartj/ehaf097
Experte
- 60323 Frankfurt am Main
- [email protected]
- www.herzzentrum-an-der-alster.de
Prof. Dr. med. Thomas Meinertz ist Kardiologe und Pharmakologe in Hamburg. Zu den Schwerpunkten des ehemaligen Vorsitzenden der Herzstiftung und langjährigen Direktors der Klinik und Poliklinik für Kardiologie und Angiologie des Universitären Herzzentrums Hamburg zählen insbesondere Herzrhythmusstörungen, die koronare Herzkrankheit und Herzklappen-Erkrankungen. Neben mehreren hundert wissenschaftlichen Fachpublikationen, die Prof. Meinertz für nationale und internationale Fachzeitschriften verfasst hat, ist der renommierte Kardiologe Chefredakteur der Herzstiftungs-Zeitschrift "HERZ heute" und Autor mehrerer Publikationen im Online-Bereich der Herzstiftung.