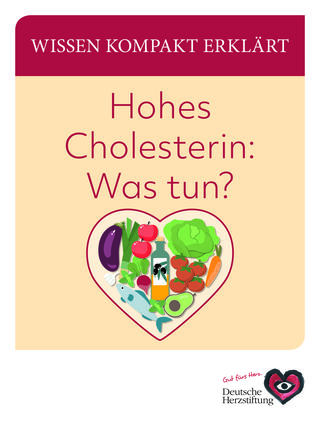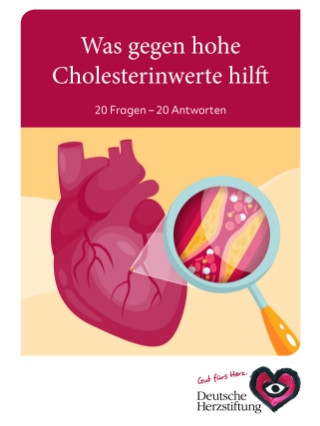Cholesterin verstehen – Risiken erkennen
Erhöhte Cholesterinwerte sind ein weit verbreitetes, oft unterschätztes Gesundheitsrisiko. Denn die Folgen entwickeln sich meist schleichend – ohne spürbare Symptome. Besonders, wenn wir zu viel LDL-Cholesterin im Blut haben, kann das über Jahre hinweg Ablagerungen in den Blutgefäßen fördern und damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich erhöhen.
In unserer Broschüre „20 Fragen – 20 Antworten rund ums Cholesterin“ erhalten Sie kompakte und fundierte Informationen zu den häufigsten Fragen: Welche Cholesterinwerte gibt es? Wie wirken sie sich auf die Gesundheit aus? Und welche Rolle spielen Lebensstil und Medikamente bei der Behandlung? Die vollständige Broschüre mit allen 20 Fragen und Antworten können Sie hier kostenfrei bei uns bestellen (unter Ratgeber/Faltblätter).
Vorschau: die 5 häufigsten Fragen rund um Cholesterin?
Wir haben für Sie die fünf wichtigsten Fragen aus unserer Broschüre bereits online zusammengestellt:
- Welche Blutfettwerte gelten als normal?
- Was bringt den Cholesterinspiegel aus dem Lot?
- Sind bestimmte Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel zur LDL-Senkung empfehlenswert?
- Mit welchen Medikamenten lässt sich der LDL- und der Triglyzerid-Wert senken?
- Wie hoch ist das Risiko von Muskelschmerzen durch Statine?
Welche Blutfettwerte gelten als normal?
Die Normwerte (Auswahl) bei gesunden Erwachsenen sind:
- Gesamt-Cholesterin: <200 mg/dl (<5,2 mmol/l)
- LDL-Cholesterin: <116 mg/dl (<3,0 mmol/l)
- HDL-Cholesterin: >35 mg/dl (>0,9 mmol/l) - bei Männern idealerweise >40 mg/dl (1,0 mmol/l) und bei Frauen >50 mg/dl (1,3 mmol/l)
- Triglyzeride: <150 mg/dl (<1,7 mmol/l)
Werden diese Werte überschritten, wird der Arzt gemeinsam mit Ihnen genauer schauen, woran das liegen kann und ob durch Lebensstilveränderungen und/oder Medikamente eine Normalisierung der Blutfett-Werte ratsam ist.
Das Behandlungsziel bei erhöhten LDL-Cholesterinwerten wird für kranke Menschen bzw. solche mit gesundheitlichen Risikofaktoren (z.B. fortgeschrittenes Alter, Bluthochdruck, Rauchen und Übergewicht sowie bereits bestehende Herz-Kreislauf-Erkrankungen) dann noch strenger definiert und es werden je nach Ausgangslage niedrigere LDL-Werte als der Normalwerte angestrebt. Denn entscheidend ist das Gesamtrisiko für Herz und Kreislauf. Wie viel LDL-Senkung für eine ausreichende Risikominderung empfehlenswert ist, ist in wissenschaftlichen Studien ermittelt worden und wird in den medizinischen Leitlinien für die Therapie festgelegt.
Das sind aktuelle LDL-Zielwerte bei einer Behandlung:
- bei mittelgroßem Herz-Kreislauf-Risiko <100 mg/dl (<2,6 mmol/l),
- bei hohem Risiko <70 mg/dl (<1,8 mmol/l
- bei bekannten Gefäßverkalkungen oder sehr hohem Risiko <55 mg/dl (<1,4 mmol/l) oder eine Senkung um ≥50 % vom Ausgangswert.
Was bringt den Cholesterinspiegel aus dem Lot?
Der LDL-Cholesterinspiegel ist im Wesentlichen genetisch bedingt. Ungünstig wirken eine fett- und energiereiche Über-Ernährung kombiniert mit Bewegungsmangel. Hinzu kommen manchmal bestimmte Grunderkrankungen, die teils vererbt sein können, sowie Hormonveränderungen oder Medikamente.
Dies Faktoren können die Cholesterinwerte beeinflussen:
- Unterfunktion der Schilddrüse (Hypothyreose)
- Diabetes und Adipositas
- Leber- und Nierenerkrankungen
- Schwangerschaft oder Wechseljahre (durch Hormonveränderungen)
- Medikamente (Glukokortikoide, Gestagene, Androgene)
- Lymphdrüsenkrebs (Lymphome)
- erbliche Veranlagung
- Lebensstil (fettreiche Ernährung, Bewegungsmangel, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum)
Sind bestimmte Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel zur LDL-Senkung empfehlenswert?
Es gibt keine wissenschaftlich verlässlichen Belege dafür, dass der Verzehr bestimmter Lebensmittel wie Weizenkleie oder gar die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln (etwa mit Kurkuma oder Rotem Reis) das Gesamtcholesterin und vor allem den LDL-Wert in nennenswertem Ausmaß senken. Das gilt auch für eine mediterrane Ernährungsweise. In allen Studien führte eine „mediterrane“ Kost leider NICHT zu einer Senkung des Cholesterins.
Bei einem hohen Cholesterin-Wert im Blut – einem der fünf großen Herzrisiken – wird die sogenannte Mittelmeer-Diät dennoch meist als therapiebegleitende Maßnahme empfohlen. Denn eine gemüsebetonte Vollwerternährung mit vielen Ballaststoffen (unter anderem aus Hülsenfrüchten) und kontrolliertem Konsum von Ölen und Fetten, die reich an ungesättigten Fettsäuren sind (etwa aus Raps- und Olivenöl, Nüssen und Samen), wird mit einem insgesamt verringerten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht.
Mit welchen Medikamenten lassen sich LDL- und Triglyzerid-Wert senken?
Vor allem zur Senkung erhöhter LDL-Werte steht heute eine Palette von Wirkstoffen mit unterschiedlichen Wirkprinzipien zur Verfügung. Eine Behandlung wird unabhängig vom Alter und Geschlecht empfohlen. Das sind die medikamentösen Behandlungsoptionen:
- Statine: Mittel der ersten Wahl, bewirken, dass die Leber weniger Cholesterin produziert. Die Leberzellen bilden als Reaktion darauf vermehrt LDL-Rezeptoren auf ihren Oberflächen, so dass die LDL-Partikel aus dem Blut aufgenommen werden.
- Ezetimib: hemmt die Fett-Aufnahme im Darm, kann die Wirkung eines gleichzeitig gegebenen Statins verstärken.
- Bempedoinsäure: wirkt ähnlich wie Statine, ist geeignet u.a. für Patienten, die unter Statintherapie Muskelschmerzen entwickeln.
- PCSK9-Hemmer: hemmen die bremsende Wirkung eines Enzyms (PCSK9) auf den Abbau des LDL-Cholesterins. Folge: Der LDL-Abbau wird beschleunigt. Einsatz besonders bei Patienten mit hohem Herz-Kreislauf-Risiko und bei familiärer Hypercholesterinämie (genetisch bedingt hohe Blutfettwerte) empfohlen. Sie werden im Abstand von einigen Wochen oder Monaten unter die Haut gespritzt.
- Reservemedikamente: Sie sind weniger wirksam als die oben genannten Wirkstoffe und es ist zweifelhaft, ob mit diesen Wirkstoffen Herzinfarkte verhindert werden können. Daher kommen die folgenden Medikamente nur selten und in besonderen Situationen zum Einsatz: Anionen-Austauscherharze (Colesevelam, Colestyramin) und Fibrate (Bezafibrat, Fenofibrat).
Wie hoch ist das Risiko von Muskelschmerzen durch Statine?
Zu über 90 Prozent stehen empfundene Muskelschmerzen nicht im Zusammenhang mit der Therapie. Aus Studien geht hervor, dass Schmerzen aus dem Bewegungsapparat (und damit anderer Ursache) oft fälschlicherweise als Muskelschmerz interpretiert werden. Teilweise scheint eine negative Erwartungshaltung von Personen, die Statine einnehmen, dazu beizutragen (Nocebo-Effekt). Dennoch kann es unter Statinen gelegentlich (je nach Wirkstoff und Dosis) zu Muskelschmerzen kommen. Dann ist es ist die Aufgabe des behandelnden Arztes, die medikamentöse Therapie in geeigneter Weise anzupassen (z.B. andere Dosierung, anderes Medikament derselben Wirkstoffklasse, Wechsel auf eine andere Wirkstoffklasse).
Die gefürchtete Rhabdoymolyse (Zerfall von Muskelfasern) ist äußerst selten und macht sich durch ausgeprägte Muskelschmerzen und Muskelschwäche, Fieber sowie rötlich-braunen Urin bemerkbar.
Cholesterin im Überblick
-
![Cover der Broschüre]()
Cholesterin
PDF: 2,91 MB -
![Titelbild des Covers 20 Fragen Cholesterin]()
Experte
Univ.-Prof. Dr. med. Ulrich Laufs ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Professur für Kardiologie an der Universität Leipzig und Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig.